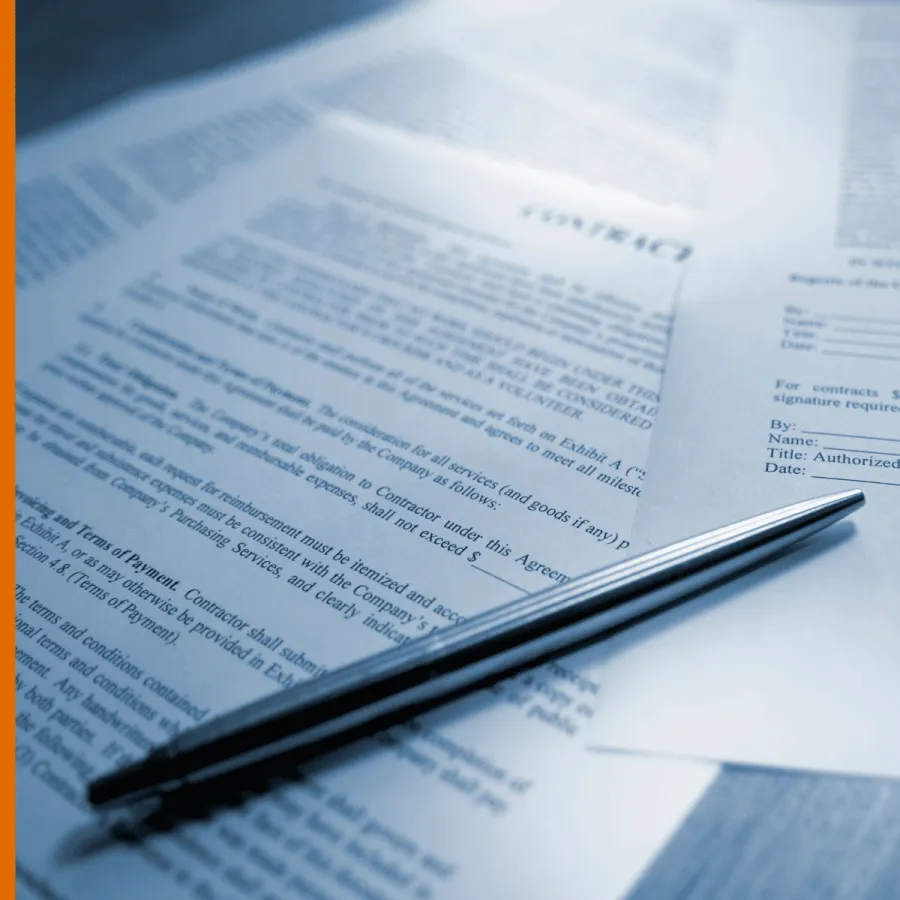Risiken im Zusammenhang mit Insolvenzanfechtungen managen.
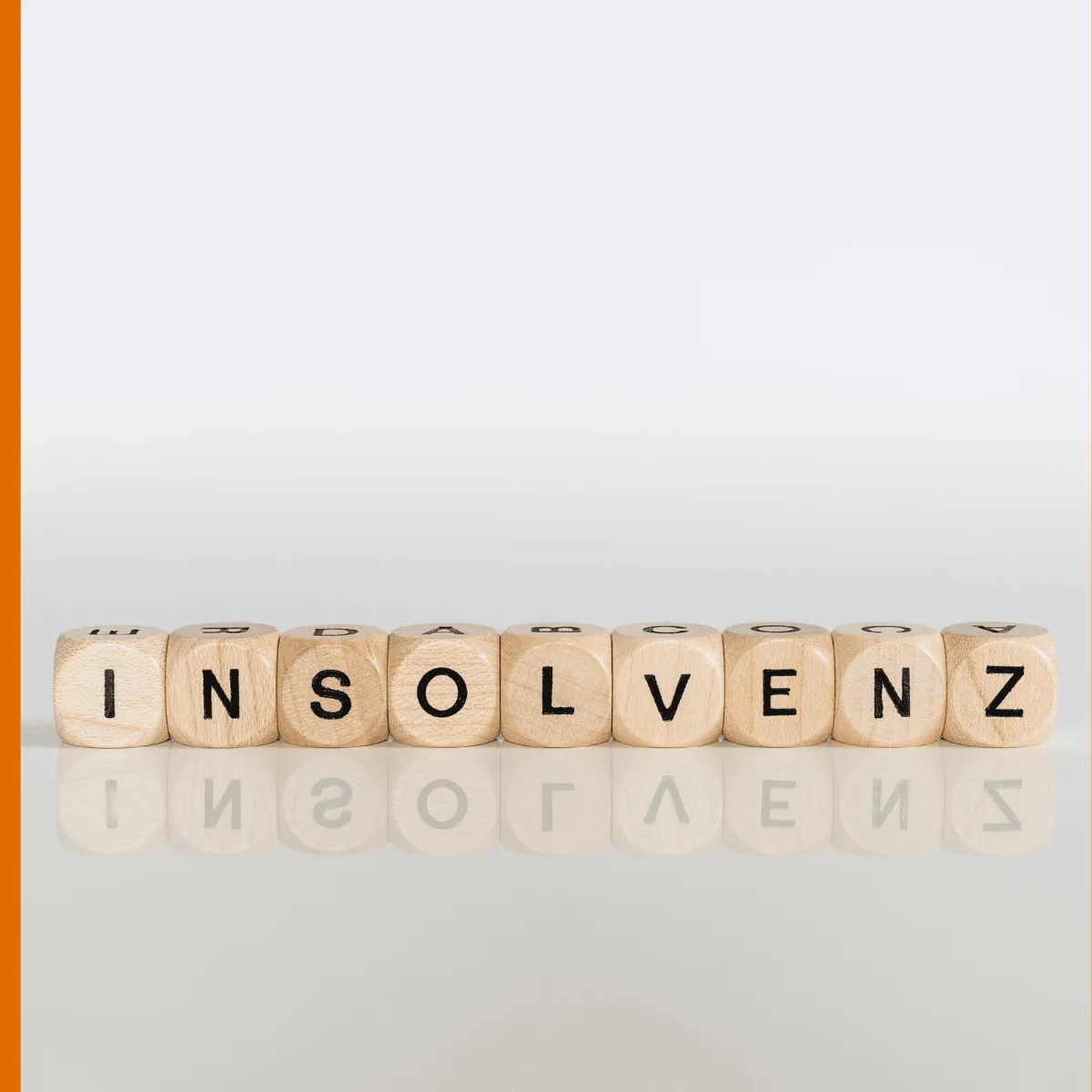
Dazu zählen etwa Zahlungen oder Leistungen des Gläubigers, die der Insolvenz schuldhaft vorausgegangen sind. Damit soll verhindert werden, dass die Forderungen einzelner Gläubiger bevorzugt bedient werden und andere Gläubiger benachteiligt werden.
Das bedeutet: Auch vermeintlich ordnungsgemäß erhaltene Zahlungen – teilweise Jahre zurückliegend – können zurückgefordert werden. Das Ziel des Gesetzgebers ist damit nachvollziehbar: eine Gleichbehandlung aller Gläubiger. Für das betroffene Unternehmen kann dies aber enorme Risiken bergen, insbesondere dann, wenn hohe Beträge im Raum stehen und die Rückforderung die eigene Liquidität gefährdet.
Besonders einschneidend ist die sogenannte Vorsatzanfechtung nach § 133 Abs. 1 InsO, die Rückforderungen über einen nicht unerheblichen Zeitraum ermöglicht. Hierbei geht es darum, ob der Schuldner bei der Zahlung mit dem Vorsatz handelte, Gläubiger zu benachteiligen – und ob der Zahlungsempfänger dies erkennen konnte.
Strenge Rechtsprechung als Risikofaktor
Die Rechtsprechung hat den Anwendungsbereich dieser Vorschrift in den vergangenen Jahren deutlich ausgeweitet. Für Unternehmen ergibt sich dadurch ein erhöhtes Risiko, Zahlungen zurückgeben zu müssen.
Typische Indizien für einen Benachteiligungsvorsatz können sein:
- erfolglose Vollstreckungsversuche gegen den Schuldner,
- Rückstände bei Steuern und Sozialabgaben,
- Bitten des Schuldners um Ratenzahlungen oder Stundungen.
Obwohl der Bundesgerichtshof (BGH) klargestellt hat, dass eine übliche Bitte um Ratenzahlung allein nicht automatisch ein Indiz für Benachteiligung ist, wird das Risiko schon dann größer, wenn der Schuldner erklärt, ohne diese Erleichterung seine Verbindlichkeiten nicht mehr bedienen zu können.
Auch die Berufung auf ein sogenanntes Bargeschäft schützt nicht immer.
Die Folge: Selbst Geschäftsvorfälle, die nach außen hin geordnet wirken, können später angefochten werden. Diese Rechtsunsicherheit macht die Risikosituation für Unternehmen besonders schwer kalkulierbar.
Welche Risiken entstehen für Unternehmen?
- Finanzielle Belastungen: Rückzahlungen können auch Jahre nach Geschäftsvorgängen gefordert werden.
- Liquiditätsprobleme: Plötzliche Rückforderungsansprüche gefährden die Zahlungsfähigkeit.
- Rechtsunsicherheit: Auch reguläre Zahlungen sind nicht sicher vor einer Anfechtung.
- Hoher Aufwand: Unternehmen müssen Zeit und Kosten in rechtliche Auseinandersetzungen investieren.
Absicherung durch eine Insolvenzanfechtungsversicherung
Angesichts der strengen Rechtsprechung ist eine aktive Risikoabsicherung sinnvoll. Eine Insolvenzanfechtungsversicherung bietet hier gezielten Schutz:
- Übernahme von Rückforderungen: Der Versicherer zahlt angefochtene Beträge bis zur vereinbarten Summe.
- Rechtsschutzfunktion: Oft werden auch die Kosten für Anwälte und Gerichtsverfahren übernommen.
- Integration in Kreditversicherung: Viele Anbieter kombinieren die Absicherung mit bestehenden Kreditversicherungslösungen.
Unternehmen können dadurch ihre Liquidität schützen und ihre Planbarkeit erhöhen. Besonders für Branchen mit hohen Rechnungsbeträgen und langen Zahlungszielen – etwa Industrie, Handel oder Bauwirtschaft – ist dies ein entscheidender Vorteil. Gerade in Zeiten, in welchen genau dieses Risiko steigt, sollten Unternehmen ihre Risikovorsorge erhöhen.
Fazit
Die Insolvenzanfechtung ist für Unternehmen ein erhebliches Risiko. Die Rechtsprechung hat den Anwendungsbereich der Vorsatzanfechtung nach § 133 InsO erweitert und die Anforderungen verschärft. Selbst scheinbar unproblematische Geschäftsvorgänge können Jahre später rückabgewickelt werden.
Eine Insolvenzanfechtungsversicherung schafft hier Sicherheit. Sie bewahrt Unternehmen vor finanziellen Belastungen durch Rückforderungen, übernimmt rechtliche Kosten und schützt die Liquidität. Damit ist sie ein wesentlicher Baustein im professionellen Risikomanagement.